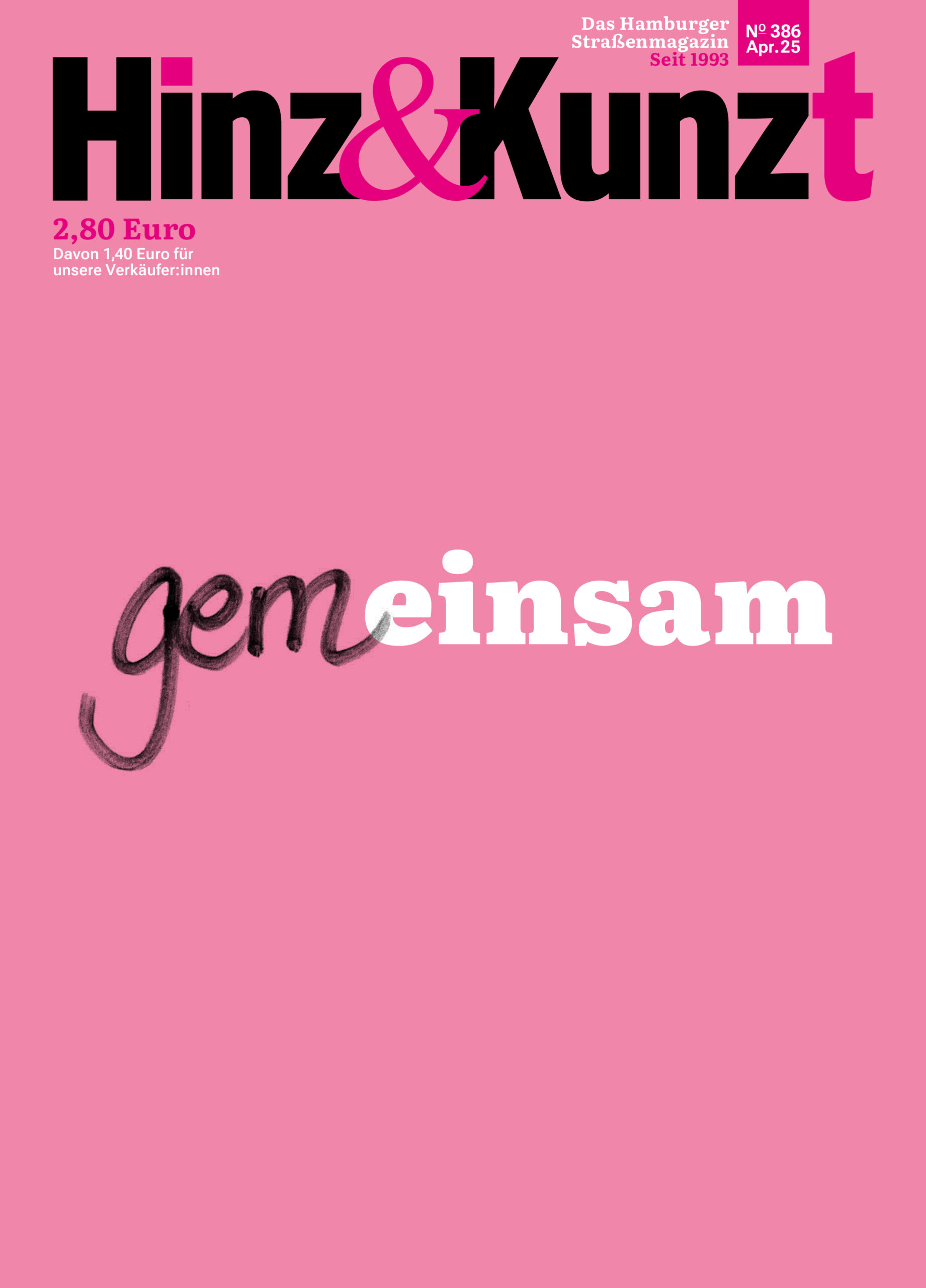In seiner Porträtserie „Jahrhundertfrauen“ schreibt Frank Kürschner-Pelkmann über Johanna Goldschmidt und das Engagement der Frauenrechtlerin für den Aufbau von Kindergärten.
Johanna Schwabe wurde am 11. Dezember 1806 in eine wohlhabende jüdische Familie in der Hamburger Neustadt geboren. Der Vater gehörte 1817 zu den Gründern des liberalen „Neuen Israelitischen Tempel-Vereins“, einer Reformbewegung mit dem Ziel, jüdische Tradition und modernes Leben in Einklang zu bringen.
Johanna erhielt Unterricht durch einen Privatlehrer und den angesehenen Prediger der Reformgemeinde Eduard Kley. Am Ende ihrer Schulzeit hatte sie mehrere Sprachen erlernt und verfügte über eine breite religiöse und kulturelle Bildung. Sie engagierte sich zeitlebens für eine Emanzipation der Juden und gegen einen opportunistischen Religionswechsel zum Christentum.
1827 heiratete sie den jüdischen Kaufmann Moritz David Goldschmidt. Das wohlhabende Paar hatte acht Kinder. Die fehlende Emanzipation der Juden war auch für bürgerliche Familien spürbar, und so gründete Johanna Goldschmidt 1848 mit jüdischen und christlichen Frauen den „Socialen Frauenverein zur Bekämpfung und Ausgleichung confessioneller Vorurteile“. Als 1849 viele Benachteiligungen der jüdischen Minderheit beseitigt wurden, feierten die Frauen gemeinsam ein ausgelassenes Fest.
Für Frauen – jüdische wie christliche – blieben zahlreiche Benachteiligungen bestehen. Johanna Goldschmidt beteiligte sich deshalb 1849 an der Gründung des „Allgemeinen Bildungsvereins deutscher Frauen“. Auf dessen Initiative hin entstand 1850 unter Mitwirkung von Johanna Goldschmidt die „Hochschule für das weibliche Geschlecht“. Die stieß umgehend auf Widerstand bei den Verfechtern einer patriarchalen Gesellschaft. Unter großem gesellschaftlichen und finanziellen Druck musste die Hochschule bereits nach zwei Jahren schließen.
Johanna Goldschmidt konzentrierte sich nun auf die Erziehung von „ganz freien Menschen“. Diese musste nach ihrer Überzeugung im frühen Kindesalter beginnen. Sie stand den „Kinderbewahranstalten“ ihrer Zeit ablehnend gegenüber, die ohne pädagogischen Anspruch der Ruhigstellung der Kinder dienten. Eine Alternative boten die Kindergärten, wie sie der Reformpädagoge Friedrich Fröbel propagierte. Hier wurden die Kinder von ausgebildeten pädagogischen Kräften betreut und konnten mit Bällen, Würfeln und anderem Spielzeug ihre Fertigkeiten verbessern. Johanna Goldschmidt bat Fröbel 1849, in Hamburg ein halbes Jahr lang einen Ausbildungskurs für Kindergärtnerinnen zu leiten. Die daraus entstandenen gut ausgestatteten und teuren Kindergärten blieben allerdings den bürgerlichen Kreisen vorbehalten. Johanna Goldschmidt hielt an ihrem Engagement für die Benachteiligten fest und beteiligte sich deshalb an der Gründung einer Schule für Kinder aus armen Familien.
1860 ergriff sie die Initiative für einen Fröbel-Verein, der sich für die Kindergärtnerinnen-Ausbildung und den Aufbau von Kindergärten engagierte. Aus dieser Bildungseinrichtung ging die heutige Hamburger Fachschule für Sozialpädagogik hervor. Als Johanna Goldschmidt am 10. Oktober 1884 starb, hatte sie solide Grundlagen für eine professionelle Kinderbetreuung gelegt.